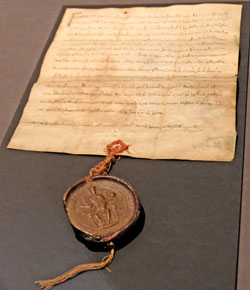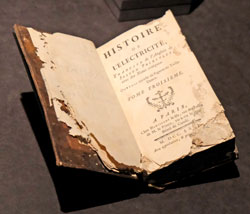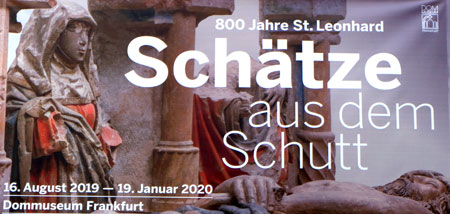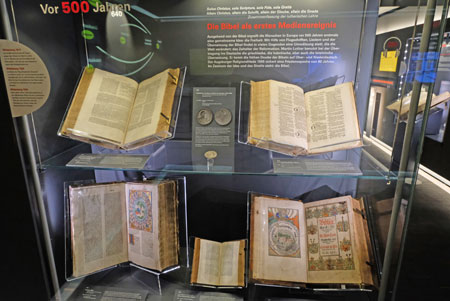(ffm) Nach über viermonatiger Schließung aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie öffnen die städtischen Museen für Besucherinnen und Besucher wieder sukzessive ihre Türen. Möglich macht dies der aktuelle Beschluss der Landesregierung. Voraussetzung ist, dass der Inzidenzwert hessenweit zwischen 50 und 100 pro 100.000 Einwohner liegt, die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher erfasst werden und Besuchstermine vereinbart werden können.
„Ich begrüße es sehr, dass die Museen und das Institut für Stadtgeschichte zu den ersten gehören, die wieder öffnen können. Wir sind mit entsprechenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen gut vorbereitet, um einen risikoarmen Besuch zu gewährleisten. Ich danke den Direktorinnen und Direktoren der Häuser, dass sie die aktuell geltenden Regeln so umsichtig umgesetzt haben, verantwortungsvoll mit der Situation umgehen und eine zeitnahe Öffnung der Häuser ermöglichen. In vielen der Museen wurden im zweiten Lockdown neue Ausstellungen eröffnet, die jetzt nur darauf warten, besucht zu werden“, sagt Kulturdezernentin Ina Hartwig. Für den Museumsbesuch gelten die bekannten Hygienebestimmungen: Tragen einer medizinischen Maske, Abstand halten und regelmäßig die Hände wasche und desinfizieren.
Archäologisches Museum Frankfurt

Das Museum öffnet am Dienstag, 9. März, wieder seine Türen für die Besucherinnen und Besucher. Es warten zwei besondere Ausstellungen auf ihre Gäste: Die Präsentation „Der Thoraschrein der Synagoge am Börneplatz“ ist noch bis zum 18. April zu sehen, bis zum 11. April zeigt das Haus die Ausstellung „SYRIEN. Fragmente einer Reise, Fragmente einer Zeit“ mit Fotografien von Yvonne v. Schweinitz (1921-2015). Der Besuch des Archäologischen Museums ist nur unter der Voraussetzung möglich, dass die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher vor Ort erfasst werden und im Vorfeld Besuchstermine vereinbart werden. Man kann sich ab Dienstag, 9. März, unter der Telefonnummer 069/212-35896 für eine bestimmte Uhrzeit anmelden. Der Zugang sowohl zur Dauerausstellung als auch zur Sonderausstellung ist aus organisatorischen Gründen vorerst nur über den Haupteingang des Museums in der Karmelitergasse 1 möglich: https://archaeologisches-museum-frankfurt.de/de/
Caricatura Museum Frankfurt

Das Caricatura Museum öffnet am Dienstag, 16. März, wieder seine Türen für die Liebhaber der komischen Kunst. Die aktuelle Ausstellung „Grober Strich und feiner Witz“ mit Cartoons von Hauck & Bauer wurde bis zum 11. Juli verlängert. Die genauen Bedingungen für einen Besuch können zeitnah der Website des Museums entnommen werden: https://caricatura-museum.de/
Deutsches Architekturmuseum

Das Deutsche Architekturmuseum öffnet wieder am Freitag, 12. März, mit neuen Öffnungszeiten: dienstags von 12 bis 18 Uhr, mittwochs von 12 bis 20 Uhr, donnerstags von 12 bis 20 Uhr und freitags von 12 bis 20 Uhr. Am Samstag und Sonntag ist das Haus von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Haus zeigt derzeit „max40 – BDA Architekturpreis für junge Architektinnen und Architekten“ bis zum 11. April, „Best Highrises 2020/21 – Internationaler Hochhaus Preis 2020“ bis zum 16. Mai und „DAM Preis 2021 – Die 25 besten Bauten in/aus Deutschland“ bis 13. Juni, sowie „Einfach Grün – Greening the City“ bis 11. Juli. Die genauen Bedingungen für einen Besuch können zeitnah der Website des Museums entnommen werden; https://dam-online.de/
Historisches Museum Frankfurt und Junges Museum Frankfurt

Das Historische Museum Frankfurt öffnet wieder am Samstag, 13. März, mit den vor dem zweiten Lockdown geltenden Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Über den Online-Shop der Website oder den Besucherservice des Museums (per Mail an besucherservice@historisches-museum-frankfurt.de oder unter Telefon 069/212-35154) kann ein Zeitslot gebucht werden (jeweils zweistündig, ab den Öffnungszeiten am Tag gerechnet). Die neue, große Ausstellung „Frankfurter Gartenlust – Die Stadt und das Grün“ ist ab Donnerstag, 25. März, zu sehen. Die Ausstellung des Jungen Museums ist ab Dienstag, 30. März, zu sehen, Spielräume und Werkstätten bleiben vorerst geschlossen. Für einen Besuch muss man sich ebenfalls ein Ticket des Historischen Museums über den Online-Shop holen, dass den Eintritt in das Junge Museum inkludiert: https://historisches-museum-frankfurt.de/
Institut für Stadtgeschichte

Das Institut für Stadtgeschichte öffnet am Dienstag, 9. März, seinen Lesesaal, die Sammlungen und Ausstellungen. Für den Lesesaal, die Sammlungen und den Ausstellungsbesuch ist eine Voranmeldung erforderlich, Informationen dazu sind auf der Website des Museums zu finden. Derzeit sind im Institut für Stadtgeschichte folgende Ausstellungen zu sehen: „Bewegte Zeiten: Frankfurt in den 1960er Jahren“ bis zum 18. April, „Eberhard Steneberg: Zwischen allen Stühlen“ bis zum 9. Mai und die Dauerausstellung „Jörg Ratgeb: Die Wandbilder im Karmeliterkloster“: https://www.stadtgeschichte-ffm.de/
Jüdisches Museum Frankfurt
Das Jüdische Museum präsentiert bis Mittwoch, 10. März, täglich zwischen 19 und 22 Uhr auf dem Museumsvorplatz eine interaktive Lichtinstallation rund um die Skulptur „Untitled“ von Ariel Schlesinger. Ab Donnerstag, 11. März, öffnet das Jüdische Museum am Bertha-Pappenheim-Platz den Lichtbau mit der Bibliothek und die Dauerausstellung im Rothschild-Palais. Besucherinnen und Besucher können sich ab Mittwoch, 10. März, auf der Website des Museums ein Zeitslot- und/oder Online-Ticket buchen. Sie werden vor Ort von Besucherbetreuerinnen und -betreuern empfangen, die individuelle Kurzführungen anbieten. Am Donnerstag, 18. März, öffnet das Haus zusätzlich die Wechselausstellung „Die weibliche Seite Gottes“ im Lichtbau. Die im Oktober eingeführten Öffnungszeiten bleiben bestehen: Dienstag und Donnerstag von 10 bis 21 Uhr, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr; https://www.juedischesmuseum.de/
Museum Angewandte Kunst

Das Museum Angewandte Kunst öffnet am Dienstag, 9. März, um 12 Uhr. Beim Museum Angewandte Kunst ist eine Terminvergabe per Mail, Telefon oder an der Kasse möglich. Folgende Ausstellungen sind neben der Dauerausstellung zu sehen: „ars viva 2021, Rob Crosse, Richard Sides, Sung Tieu“ bis zum 21. März, „ANETTE LENZ. à propos“ bis zum 16. Mai und „亞歐堂 meet asian art: Schalen. Metamorphosen einer Grundform“ bis zum 7. November. Ab dem 16. April zeigt das Haus „Dieter Rams. Ein Blick zurück und voraus“. Das Haus hat dienstags von 12 bis 18 Uhr, mittwochs von 12 bis 20 Uhr und donnerstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Das zugehörige Ikonenmuseum öffnet am Dienstag, 16. März, um 10 Uhr. Die genauen Bedingungen für einen Besuch befinden sich noch in der Planung und können zeitnah der Website des Hauses entnommen werden. Das Museum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr und mittwochs von 12 bis 20 Uhr geöffnet: https://www.museumangewandtekunst.de/
Museum Judengasse

Am Donnerstag, 25. März, erfolgt die Öffnung des Museums Judengasse. Die Öffnungszeiten sind: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Besucherinnen und Besucher können sich zeitnah vor der Wiedereröffnung online ein Zeitslot- und/oder Online-Ticket buchen: https://www.juedischesmuseum.de/besuchen/museum-judengasse/
Tower MMK
Das Museum MMK für Moderne Kunst öffnet ab Dienstag, 9. März, wieder den TOWER MMK. Dort ist die Ausstellung „Sammlung“ zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr und Mittwoch von 11 bis 20 Uhr: https://www.mmk.art/de/visit/tower/
Weltkulturen Museum

Das Weltkulturen Museum hat wegen Ausstellungsumbaus erst ab Donnerstag, 1. April, wieder geöffnet. Dann wird die neue, gerade im Aufbau befindliche Ausstellung im Haupthaus „Grüner Himmel, blaues Gras. Farben ordnen Welten“ gezeigt. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Mittwoch von 11 bis 20 Uhr. Die Möglichkeiten zur Buchung von Terminen für den Ausstellungsbesuch, auch schon im Voraus, werden nach organisatorischer Klärung über die Website des Hauses bekannt geben: https://www.weltkulturenmuseum.de/de/
Weitere Informationen sind auf den Webseiten der einzelnen Häuser sowie unter http://www.museumsufer.de zu finden. Die Informationen werden laufend aktualisiert.
MuseumsuferCard
Für Inhaberinnen und Inhaber der MuseumsuferCard geht die Wiederöffnung der Museen mit einer Verlängerung ihrer Jahreskarte einher. Die Laufzeit der MuseumsuferCard wurde bereits für den ersten Lockdown um zwei Monate verlängert, für den zweiten Lockdown ist die Gültigkeit der Karte um weitere vier Monate ausgeweitet worden. MuseumsuferCard-Inhaberinnen und -Inhaber müssen nichts tun: Die Verlängerung wurde auf dem QR-Code der Karte automatisch gespeichert: https://www.museumsufercard.de/