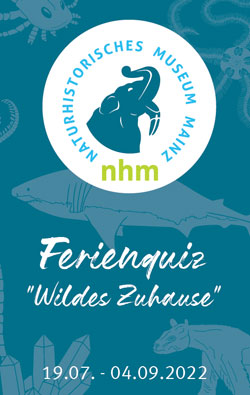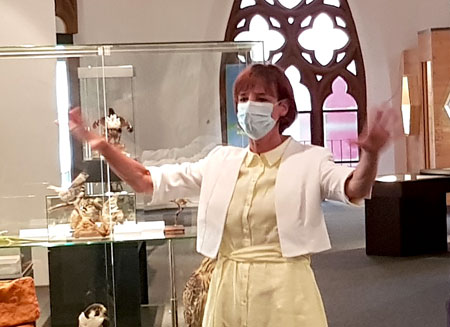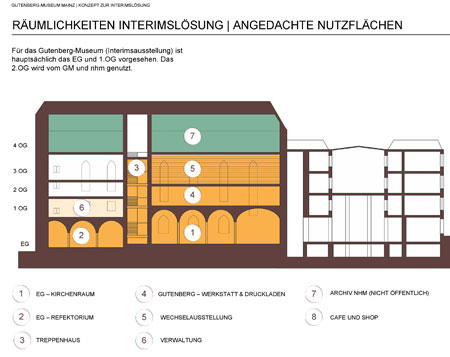Wie das rheinland-pfälzische Innenministerium mitteilt hat ein internationales Forscherteam um das Urweltmuseum Geoskop bei Kusel im Auftrag von Erdgeschichte-Experten der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz zwischen Kaiserslautern und Trier eine neue Ursaurierart nachgewiesen. Das nach seiner speziellen Kopfform Stenokranio („Schmalschädler“) benannte Tier wurde bis zu anderthalb Meter lang, hatte einen großen, flachen Schädel mit vielen spitzen Zähnen und ernährte sich von Fischen und anderen Ursauriern. Es lebte vor knapp 300 Millionen Jahren und war eines der größten Raubtiere seiner Zeit.
„Zu Lebzeiten von Stenokranio lag die Pfalz nahe des Äquators und war Teil eines riesigen Gebirgstals, das sich von Lothringen bis Frankfurt am Main erstreckte und eine tropische Fluss- und Seenlandschaft beherbergte. Im Bereich des heutigen Remigiusbergs bei Kusel mündete damals ein großer Fluss in einen etwa 70 Kilometer langen See. Dieses Flussdelta bevölkerte die neu entdeckte Ursaurierart. Es ist faszinierend, dass wir heute erstmals Überreste dieses urzeitlichen Rheinland-Pfälzers finden und dadurch Erkenntnisse über eine längst vergangene Epoche erlangen“, sagte Innenminister Michael Ebling.
Auch die Generaldirektorin der GDKE, Dr. Heike Otto, zeigte sich ob der Neuentdeckung begeistert. „Die beiden fossilen Schädel wurden bereits 2013 und 2018 entdeckt und auch mithilfe von Ehrenamtlichen ausgegraben. Ein internationales Forscherteam konnte diese dann präparieren und nun die Beschreibung einer neuen Art vornehmen. Der sensationelle Fund führt uns den erdgeschichtlichen Reichtum unserer Region eindrucksvoll vor Augen“, so Otto.
Stenokranio besetzte die ökologische Nische der späteren Krokodile. Es war ein Amphib, das im Wasser und an Land leben konnte. Als Fisch- und Fleischfresser, dürfte er als Lauerjäger im Flachwasser und am Ufer von Seen und Flüssen seiner Beute nachgestellt haben. Neben frühen Vorläufern der Säugetiere gehörte Stenokranio zu den größten bekannten Raubtieren seiner Zeit.
Stenokranio ist Teil der ältesten gut belegten Ursauriergemeinschaft Europas, die vom Remigiusberg bei Kusel in der Westpfalz stammt. An Vierfüßern wurden aus dem pfälzischen Fossilvorkommen bisher Reste von drei weiteren Ursaurierarten (Cryptovenator hirschbergeri, Remigiomontanus robustus, Trypanognathus remigiusbergensis) beschrieben, deren nächste Verwandtschaft im heutigen Südwesten der USA und in Thüringen beheimatet war. Die „Ursaurier“ haben nichts mit den Dinosauriern zu tun, sondern lange vor diesen gelebt. Die ersten Dinosaurier traten etwa 60 Millionen Jahre nach Stenokranio auf.
Ein Teil der Fossilien ist bereits in die Dauerausstellung des Urweltmuseums Geoskop bei Thallichtenberg (Landkreis Kusel) integriert und damit der Öffentlichkeit zugänglich. Geplant ist der Bau eines lebensgroßen Modells von Stenokranio.
Fakten zu Ursaurier Stenokranio
Um welches Tier handelt es sich?
Stenokranio war ein Amphib, also ein Tier, das im Wasser und an Land leben konnte. Die Vermehrung erfolgte durch Laichen im Wasser.
Wie viel und welches Fossilmaterial gibt es?
Die Beschreibung der neuen Art beruht auf zwei fossilen Schädeln, 25 und 27 Zentimeter lang. Von dem größeren Exemplar gibt es zusätzlich Teile der Wirbelsäule und des Schultergürtels.
Wo wurden die fossilen Reste gefunden?
Fundort ist der Remigiusberg bei Kusel in der Westpfalz (Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz). Der Fundort befindet sich auf dem Betriebsgelände eines aktiven Steinbruchs (Hartsteinwerk Rammelsbach der Basalt AG, Linz am Rhein). Der Steinbruch fördert ein Hartgestein zur Herstellung von Straßen- und Gleisbettschotter. Fossilführend sind die Deckschichten über dem Hartgestein. Zutritt zum Betriebsgelände und zur Fundstelle sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Basalt AG möglich.
Wer und wann wurden die Fossilien entdeckt?
Die Fossilien wurden 2013 (großes Exemplar als Zufallsfund; Entdecker: Dr. Jan Fischer) und 2018 (kleineres Exemplar bei einer wissenschaftlichen Grabung des Urweltmuseums GEOSKOP; Entdecker: ehrenamtlicher Grabungshelfer Hans-Rieder
Matzenbacher) entdeckt.
Wo, wann und von wem wurden die Fossilien präpariert?

Das große Exemplar wurde 2014, das kleinere Exemplar 2018 vom geowissenschaftlichen Präparator Larry Rinehart aus Albuquerque/New Mexico ehrenamtlich im Urweltmuseum GEOSKOP bei Kusel präpariert. Eine Nachpräparation des kleineren Schädels zur wissenschaftlichen Beschreibung erfolgte 2019/2020 durch Georg Sommer, geowissenschaftlicher Präparator des Naturhistorischen Museums Schloss Bertholdsburg, in Schleusingen/Thüringen.
Wann hat das Tier gelebt?
Die Fundschichten sind knapp 300 Millionen Jahre alt und werden in das ausgehende Erdaltertum, genauer in den Grenzbereich der erdgeschichtlichen Systeme Karbon und Perm gestellt.
Wie heißen die Fundschichten?
Die Stenokranio-Fossilien wurden in Ablagerungsgesteinen der sogenannten Remigiusberg-Formation, Basis des Rotliegend im Saar-Nahe-Becken, gefunden.
Weiß man, wie die Tiere zu Tode gekommen sind?
Nein. Die bisher bekannten fossilen Reste von Stenokranio stammen von zerfallenen Skeletten, die am Ufer eines Sees (größeres Exemplar) und im Flachwasser eines Sees (kleineres Exemplar) im Schlamm begraben worden sind. Es ist möglich, dass beide Tiere eines natürlichen Todes gestorben und im Laufe der Zeit zerfallen und teilweise fortgespült worden sind.
Wie groß und schwer konnten die Tiere werden?
Stenokranio konnte schätzungsweise bis zu 1,5 Meter lang werden. Das am nächsten verwandte Tier, Eryops megacephalus aus den USA, erreichte Schädellängen von bis zu 60 Zentimeter und Körperlängen von bis zu drei Metern. Das Körpergewicht der großen amerikanischen Tiere wird auf 160 Kilogramm geschätzt. Das größte bekannte Exemplar von Stenokranio könnte bis zu 70 Kilogramm Lebendgewicht aufgewiesen haben.
Wo hat das Tier gelebt? Wie muss man sich den Lebensraum vorstellen?
Zu Lebzeiten von Stenokranio lag die Pfalz nahe dem Äquator und war Teil eines riesigen (100 x 300 Kilometer großen) Gebirgstals, das von Lothringen bis Frankfurt/M. und vom Hunsrück bis fast nach Karlsruhe reichte. Das Gebirgstal (geologisch: Lothringen-Saar-Nahe-Becken) war eine tropische Fluss- und Seelandschaft. Im Bereich des heutigen Remigiusbergs mündete damals ein großer Fluss in einen etwa 70 Kilometer langen See. Am Ufer dieses Sees bzw. im Delta des besagten Flusses hat Stenokranio gelebt.
Wie hat das Tier gelebt?
Stenokranio hat die ökologische Nische der erst seit dem Erdmittelalter auftretenden Krokodile besetzt. Es war ein Amphib, das im Wasser und an Land leben konnte. Die Vermehrung erfolgte im Wasser. Die Jungtiere werden überwiegend im Wasser, die erwachsenen Tiere im Wasser und an Land gelebt haben. Stenokranio war ein Fischund Fleischfresser, der als Lauerjäger im Flachwasser und am Ufer von Seen und Flüssen seiner Beute nachgestellt haben dürfte. Neben frühen Vorläufern der Säugetiere, wie den fleischfressenden Rückensegelsauriern, gehörte Stenokranio zu den größten bekannten Raubtieren seiner Zeit. Die Konstruktion seiner Kiefer ermöglichte kein Zerschneiden (oder Kauen) von Beute. Beutetiere wurden gepackt, mit den spitzen Zähnen und den vergrößerten Reißzähnen im Gaumen festgehalten und vermutlich mehr oder weniger im Ganzen heruntergeschlungen.
Was passiert nun mit den Fossilien? Wie geht es weiter?
Ein Teil der Fossilien ist bereits in die Dauerausstellung des Urweltmuseums GEOSKOP integriert und damit der Öffentlichkeit zugänglich. Geplant ist der Bau eines lebensgroßen Modells von Stenokranio. Alle Fossilien, das Modell und gegebenenfalls virtuelle Animationen sollen später in einer neuen Dauerausstellung zu den „Kuseler Ursauriern“ im GEOSKOP präsentiert werden.
Warum wird das Tier als Ursaurier bezeichnet?
Der Begriff „Ursaurier“ ist eine populäre Sammelbezeichnung für die Vierfüßer des Erdaltertums. Der Begriff schließt Amphibien und Reptilien ein, hat aber keine wissenschaftliche Bedeutung und hat auch nichts mit den Dinosauriern zu tun. Die „Ursaurier“ haben vor den Dinosauriern gelebt. Die ersten Dinosaurier haben etwa 60 Millionen Jahre nach Stenokranio in der Mittleren Trias gelebt.
Wo genau ist die Position von Stenokranio im Stammbaum der vierfüßigen Wirbeltiere?
Stenokranio gehört zur Familie der Eryopiden, die relativ großwüchsige, nach Gestalt und Lebensweise krokodilähnliche Amphibien des ausgehenden Erdaltertums vereint. Die Eryopiden gehören zur Gruppe der Temnospondyli, die die artenreichste Gruppe an Amphibien des Erdaltertums repräsentiert und wahrscheinlich auch die Vorläufer der heutigen Amphibien einschließt.
Wem gehören die Fossilien?
Nach dem Denkmalschutzgesetz des Landes Rheinland-Pfalz werden erdgeschichtliche Objekte von wissenschaftlicher Bedeutung mit ihrer Entdeckung Eigentum des Landes Rheinland Pfalz. Entsprechende Funde werden in der Landessammlung für Naturkunde in Mainz inventarisiert.
Wer hat welchen Anteil an der Arbeit?

Die wissenschaftlichen Forschungen und Ausgrabungen im Steinbruch am Remigiusberg bei Kusel erfolgen unter der Leitung des Urweltmuseums GEOSKOP im Auftrag und in Kooperation mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz/ Referat Erdgeschichte. Finanzielle und logistische Hilfe stellt das Hartsteinwerk Rammelsbach der Basalt AG zur Verfügung. Die Ausgrabungen werden von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus der Pfalz und dem Saarland unterstützt.
Die präparatorischen und konservatorischen Arbeiten an den Fossilien sowie die wissenschaftliche Auswertung erfolgen im Urweltmuseum GEOSKOP. Die Beschreibung und Illustration der Fossilien sowie die Analyse der verwandtschaftlichen Beziehungen zu altersgleichen Amphibien wurden von den Spezialisten für fossile Amphibien der Gruppe der Eryopiden in Schleusingen/Thüringen, am Naturkundemuseum Berlin und am New Mexico Museum of Natural History in Albuquerque/New Mexico durchgeführt.
Was macht diesen Fund so spannend?
Eryopiden, die nach dem besonders großen amerikanischen Vertreter Eryops benannte Familie von Amphibien des späten Erdaltertums, werden in Saurierbüchern oft zusammen mit Rückensegelechsen als typisch amerikanische Lebensgemeinschaft der Vordinosaurierzeit dargestellt. Die Funde vom Remigiusberg belegen, dass große krokodilartige Amphibien zusammen mit den auffälligen Rückensegelechsen und anderen aus Nordamerika bekannten Ursaurierformen auch auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands existiert haben.
Quelle – Originalarbeit: Werneburg, R., Witzmann, F., Rinehart, L., Fischer, J. & Voigt, S. (2024): A new eryopid temnospondyl from the Carboniferous-Permian boundary of Germany. – Journal of Paleontology, doi: 10.1017/jpa.2023.58.