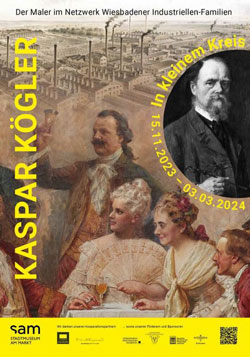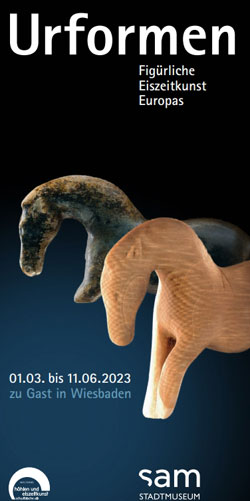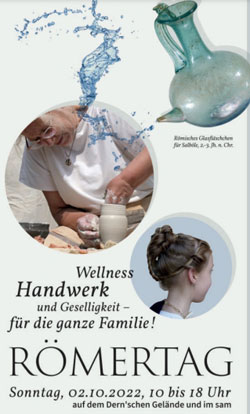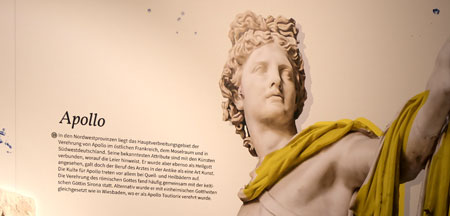Das sam – Stadtmuseum am Markt in Wiesbaden zeigt vom 20. März bis 21. Juli 2024 in der Sonderausstellung „Nach dem Leben geformt. Hans Wewerka und das Westerwälder Steinzeug des Jugendstils“ unter anderem 56 einzigartige, in Vergessenheit geratene Skulpturen des bekannten Bildhauers und Keramikers Hans Wewerka im Spannungsfeld von Jugendstil, Realismus und Expressionismus. Seine Motive zeigen vorwiegend Menschen des Alltags seiner Zeit wie Marktfrauen, Frauen mit Kindern und Wanderhändler. Kuratiert haben die Ausstellung Blanka Linnemann, M.A. und Ulrich Linnemann
Der lange Zeit nur Kennern bekannte Keramiker und Bildhauer Hans Wewerka (1888 – 1915), geboren in Nordböhmen bei Gablonz in Österreich‐Ungarn und aufgewachsen in Höhr‐Grenzhausen im Westerwald, wurde erst jüngst wiederentdeckt. Wiesbaden bildet die vierte und letzte Station der Wanderausstellung, deren Konzeption als Werkschau um neugewonnene Erkenntnisse zu Leben und Werk des im 1. Weltkrieg als Soldat jung gestorbenen Künstlers bereichert wird.
1912 erwarb das Landesmuseum Nassauischer Altertümer für den geplanten Museumsneubau an der Rheinstraße ein größeres Konvolut modernen Westerwälder Steinzeugs, darunter drei Figuren von Hans Wewerka. Das Ensemble von 18 Keramiken, dass sich im Sammlungsbestand der Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden, Sammlung Nassauischer Altertümer befindet, wird in der Ausstellung in Teilen gezeigt. Es dient als Ankerpunkt für einen erweiterten Blick auf den künstlerischen Aufbruch, der das Westerwälder Steinzeug um 1900 erfasste und die Voraussetzungen für Hans Wewerkas innovative Figurenplastik schuf.
Auch Wiesbaden hatte Anteil an dieser Entwicklung. Heute vergessen, erhielt Ernst Barlach hier 1909 auf der 1. Großen Wiesbadener Kunst‐ und Gewerbeausstellung die Goldene Medaille und den Ehrenpreis des preußischen Staates für seine von der Russlandreise 1906 inspirierte Figurenplastik. 1904/05 begegnete Hans Wewerka ihm, der noch vor seinem künstlerischen Durchbruch stand, an der Königlichen Keramischen Fachschule in Höhr als Lehrer für figürliches Modellieren und Zeichnen. Dieses Zusammentreffen prägte persönlich und künstlerisch den jungen Hans Wewerka, wie sich an seinen figürlichen Arbeiten der Frühzeit deutlich zeigt.
Hans Wewerkas Figurenplastik – empathischer Blick auf Menschen des Alltags mit künstlerischer Raffinesse und Reduktion auf das Wesentliche
Hans Wewerkas Kleinplastik entstand zwischen 1908/1909 und 1913. In dieser Zeit bildete er sich an der Kunstgewerbeschule in Düsseldorf bei Rudolf Bosselt (1871 – 1938) zum Bildhauer weiter und wirkte ab 1911 als Lehrer an der Kunstgewerbeschule Magdeburg in der Klasse für Bildhauer und Modelleure.
Die Figuren zeigen im Spannungsfeld von Jugendstil, Realismus und Expressionismus vorwiegend Menschen des Alltags wie Marktfrauen, Frauen mit Kindern und Wanderhändler. Seine Motive fand der Künstler zumeist auf der Straße und auf Marktplätzen in dem um 1900 verarmten, kleinbäuerlich geprägten Westerwald. Gezeigt werden alle bislang bekannten 56 Figuren, die 11 verschollenen im Foto. Ausgeführt zumeist in salzglasiertem Steinzeug durch die Keramikfirmen Reinhold Hanke und Reinhold Merkelbach, markieren sie den Beginn figürlicher Serienproduktion in der Westerwälder Steinzeugindustrie.
Schon die Zeitgenossen rühmen die hohe plastische Qualität von Wewerkas figürlicher Plastik, für die er, bisher unbekannt, 1910 auf der Brüsseler Weltausstellung eine Silbermedaille erhielt. Die reduzierte, blockhafte Formgebung im Frühwerk erinnert an Barlachs Figuren von Bauern und Bettlern, die nach der Russlandreise 1906 entstanden. Prägenden Einfluss, insbesondere bei der Themenwahl hatten darüber hinaus der für seine Kleinplastik gerühmte niederländische Bildhauer Joseph Mendes da Costa (1863 – 1939) sowie der Bildhauer und Reformpädagoge Rudolf Bosselt. Ausgewählte Werke aller drei Künstlern sind in der Ausstellung zu sehen.
Gezeigt werden in Wiesbaden auch die wenigen, sicher nachweisbaren Gefäßentwürfe, die Hans Wewerka mehrheitlich für die Firma Reinhold Hanke aus Steinzeug schuf. Darunter befindet sich als Leihgabe aus Magdeburger Museumsbesitz eine Bowle mit einem Fries musizierender Putten, die nunmehr zweifelsfrei als Werk von Hans Wewerka anzusehen ist.
Die Ausstellung bietet eine einzigartige Gelegenheit, das gesamte, vor allem figürlich geprägte Lebenswerk von Hans Wewerka vor dem Hintergrund seiner Biographie zu sehen und Hans Wewerkas bedeutenden Beitrag zur deutschen Keramikkunst des frühen 20. Jhs. zu würdigen.
„Nach dem Leben geformt. Hans Wewerka und das Westerwälder Steinzeug des Jugendstils“
20. März bis 21. Juli 2024 im sam – Stadtmuseum am Markt in Wiesbaden
sam – Stadtmuseum am Markt
Marktplatz, 65183 Wiesbaden
0611 – 44 75 00 60
info@stadtmuseum‐wiesbaden.de
Öffnungszeiten
Di – So 11 bis 17 Uhr, Do 11 bis 20 Uhr
Eintritt
6 € | 4 €*, Freier Eintritt für alle unter 18 Jahren.
*Ermäßigung für Studierende, Auszubildende, Freiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte, Arbeitslose,
Besitzende der Wiesbaden TouristCard, der Ehrenamtscard oder der Kurkarte sowie Fahrkarten der Thermine.