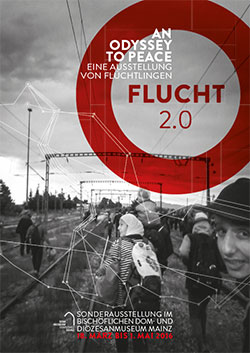Bei einem Festakt in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz wurden am 20. November 2023 sechs herausragende Integrations- und Inklusionsprojekte mit dem Helmut-Simon-Preis 2023 geehrt. Träger des Preises sind das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz, die Diakonie Hessen sowie das Diakonische Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. Die Schirmherrschafft des in diesem Jahr mit insgesamt 12.000 Euro dotierten Preises hatte die Ministerpräsidentin Malu Dreyer übernommen. Der Preis richtet sich an Personen, Initiativen und Institutionen in Rheinland-Pfalz, die sich ehrenamtlich und hauptamtlich für soziale Gerechtigkeit, Diversität, Inklusion und Integration, gegen Armut, Rassismus und Ausgrenzung einsetzen. Ein zentrales Thema ist dabei die Arbeit mit Menschen mit Fluchterfahrung. Auch zwei Sonderpreise wurden vergeben.
Infos und Kontakte zu den geehrten Projekten

„Mit dem Helmut-Simon-Preis richten die drei diakonischen Werke in unserem Land die Scheinwerfer auf Menschen, die Brücken innerhalb der Gesellschaft bauen“, so Ministerpräsidentin und Schirmherrin Malu Dreyer, und betonte: „Mit dem Preis werden diejenigen geehrt, die für soziale Gerechtigkeit und Diversität, für Integration und Inklusion einstehen. Ihr Engagement ist es, das unsere Gesellschaft offener und wärmer macht. Auf Ihrem unermüdlichen Einsatz baut eine gute Gesellschaft auf, in der alle dazugehören und teilhaben können. Dafür haben Sie die ganze Anerkennung und Wertschätzung meiner Landesregierung und von mir. Dass in unserer Gesellschaft jede und jeder die Chance hat, selbstbestimmt zu leben und unser Zusammenleben mitzugestalten, ist mir als Ministerpräsidentin sehr wichtig. Ob in der Ausbildungswerkstatt, ob beim gemeinsamen Reiten oder Theater-Spielen, ob in der Unterstützung und Rechtsberatung von Geflüchteten oder im migrationspolitischen Engagement – bei Ihnen zählt der Mensch, die Begegnung und das Empowerment.“

Albrecht Bähr, Sprecher der Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft Diakonie in Rheinland-Pfalz, begrüßte die Gäste und moderierte die Preisverleihung. Unter anderem versicherte er: „Als Diakonie stehen wir an der Seite der Menschen, die Unterstützung benötigen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Mit dem Helmut-Simon-Preis wollen wir die Menschen und ihr Engagement stärken, die den Nichtgehörten eine Stimme geben und Teilhabe ermöglichen. Durch ihren unermüdlichen Einsatz tragen sie zu einem gelingenden Leben bei und unterstützen Menschen unabhängig von Herkunft, Nationalität oder Religionszugehörigkeit. Mit großem Respekt und viel Sympathie danken wir den Menschen in Rheinland-Pfalz, die sich dafür einsetzen, dass Menschen einen festen Platz in unserer Gesellschaft finden. Mit ihrem Engagement zeigen sie, dass das Zusammenleben in unserer Gesellschaft bereichert wird, wenn alle in ihr ihren Platz finden. Für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft brauchen wir Menschen wie Sie.“

Den ersten Preis von insgesamt 4000 Euro erhielt die Ausbildungswerkstatt für benachteiligte Jugendliche des Vereins Berufliches und Soziales Lernen im Hunsrück e.V. Alexander Schweitzer, Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz, würdigte die besondere nachhaltige Leistung des Vereins Berufliches und Soziales Lernen im Hunsrück e.V. (VBS), der seit über 30 Jahren benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene erfolgreich im Tischlerhandwerk aus. Die Erfolgsquote der Absolventen liege bei 96 Prozent. Das sei ein außergewöhnlicher Erfolg. Niedrigschwellig werde hier der Weg in ein selbstbestimmtes Leben geebnet. Dabei würde bedarfsorientiert das Angebot z. B. durch ein Sprachförderangebot für Geflüchtete erweitert. Durch die bewusste Mischung der Gruppe mit Einheimischen und Geflüchteten, Behinderten und Nichtbehinderten würde Diskriminierung aktiv entgegengewirkt, Diversität und interkulturelle Verständigung gefördert. „Die Unterschiedlichkeit ist die Stärke“

Mit dem zweiten Preis (3000 Euro) wird das Projekt „Theater Inklusiv“ des Altenpflegeheims Martinsstift in Mainz (Mission Leben) ausgezeichnet. Ein besonderes Theaterprojekt für ältere und demente Menschen. Pfarrer Carsten Tag, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Hessen, unterstrich in seiner Laudatio, dass die Schauspieler mit dem Theaterspielen sich und ihre Tagesgäste in einem ganz anderen Kontext erlebten: „Sie erleben sich nicht krank, hilfsbedürftig und vielleicht auch ausgeschlossen. Nein, sie erleben sich mittendrin, selbstwirksam, mit dabei und vor allem wertgeschätzt. Und das trägt zu mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Lebensqualität bei. Einen Mehrwert hat Ihr Projekt aber auch für die professionellen Darstellenden und die Zuschauenden: Denn es entstehen Kontaktmöglichkeiten, die im Alltag nicht möglich sind und persönliche Verbindungen, die Vorurteile und Ängste abbauen können und mehr Toleranz und die Gleichwertigkeit aller Menschen stärken.“
Zwei dritte Preise (jeweils 1500 Euro) gingen an die Kindertagesstätte Nord der Stadt Ludwigshafen für ihr Projekt „Neue Welten entdecken: Reiten für alle auf dem Reiterhof der Kinderhilfe e.V.“ und die Refugee Law Clinic Trier e.V., eine studentische Initiative die Geflüchteten kostenlos Rechtsberatung anbietet.

Laudatorin Bettina Brück, Staatssekretärin im Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz unterstrich, dass es nicht viele Projekte gäbe, die auf einen Schlag so viele Wirkungen erzielten wie die Kindertagesstätte Nord der Stadt Ludwigshafen. Hinter dem Titel „Neue Welten entdecken: Reiten für alle auf dem Reiterhof der Kinderhilfe e.V.“ bleibe das Projekt keinen Zentimeter zurück: „Viele der Kinder und Eltern Ihrer Kita leben in sehr belasteten Situationen: viele in schwierigen finanziellen Lebenslagen; manche mit wenigen Kenntnissen in der Zweitsprache Deutsch, andere auch mit Fluchthintergrund, manche in unklaren Duldungssituationen, oft mit Existenzängsten.
Was tun, um Selbstvertrauen und Gemeinschaftsgefühl zu stärken, Ängste abzubauen und Kenntnisse – ob sprachlich oder der näheren Umgebung – zu erweitern? Was tun, um den Kindern und den Eltern neue Welten entdecken zu helfen? Sie haben einen Weg gefunden!, unabhängig davon, ob die Familien arm sind oder nicht, und wie sich ihre Sprachkompetenz gestaltet. Ein wahrhaft inklusives Projekt! Und ein Projekt, das anerkennt, dass Bildung im ganzheitlichen Sinne nur dann erfolgreich sein kann, wenn wir sie nicht nur als etwas betrachten, dass allein das Kind betrifft, sondern, wenn wir die Eltern und das soziale Umfeld mitdenken und miteinbeziehen.“, so die Staatssekretärin.

Bernhard Herber, Versicherer im Raum der Kirchen, zog in seiner Laudatio für den zweiten „3. Preisträger“ Refugee Law Clinic Trier e.V., eine Analogie zwischen Helmut Simons geprägtem Wort „Wer wenig im Leben hat, muss viel im Recht haben“ und dem Wirken von Refugee Law Clinic Trier e.V.. Ziel der 2014 begründeten studentischen Initiative mit mittlerweile 213 Mitgliedern und zahlreichen Unterstützern sei es,
„Asylsuchenden und Geflüchteten eine kostenlose Rechtsberatung anzubieten und ihnen damit die Möglichkeit zu geben, auch ohne finanzielle Mittel Zugang zu einem Ansprechpartner für rechtliche Fragen zu haben.“
In diesem Jahr wurden auch zwei Sonderpreise (jeweils 1000 Euro) an herausragende Initiativen verliehen, die für ihren ausdauernden und nachhaltigen Einsatz für gelingende Integration einer besonderen Würdigung verdienen. Die Preise gehen an die Ökumenische Flüchtlingshilfe Ingelheim und den Initiativausschuss für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz.

Laudatorin Katharina Binz, Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz, unterstrich das der Träger des ersten Sonderpreises, der Initiativausschuss für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz, die Migrations- und Integrationspraxis des Landes seit 35 Jahren in erheblichem Maße mitgestalte. „Der Initiativausschuss unterstützt Haupt- und Ehrenamtliche, die Menschen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte beraten und begleiten. Er bietet dazu etwa zahlreiche Beratungs- und Qualifizierungsangebote zu Asylverfahren und Flüchtlingsrecht. Neben seiner Beratungsarbeit für Haupt- und Ehrenamtliche ist ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Initiativausschusses die Lobby-, Gremien- und Vernetzungsarbeit im Themenfeld Migration und Integration.“
Ein ganz besonderes Dankeschön gelte ebenso der Ökumenischen Flüchtlingshilfe gGmbH, an die der zweite Sonderpreis „für ihr langjähriges eindrucksvolles Engagement“ ging. „Die Mitglieder der ökumenischen Flüchtlingshilfe geben seit mehr als 30 Jahren Menschen in Not im wahrsten Sinne des Wortes „festen Boden unter den Füßen. Dazu vermietet die gemeinnützige Gesellschaft eigene Wohnungen in Rheinhessen für Geflüchtete zu einem erschwinglichen Preis. Zudem begleitet sie die geflüchteten Menschen, bis sie in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Bei dieser Beratungsarbeit geht es unter anderem um Kinderbetreuung, die Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, den Umgang mit Behörden oder auch der Krankenkasse. Die Menschen mit Fluchterfahrung werden dabei über viele Jahre so intensiv unterstützt, teilweise 10 Jahre lang – dass mittlerweile erwachsene Kinder eingebürgert sind und qualifizierte Jobs gefunden haben. Auch hier haben alle Engagierten also ebenfalls einen langen Atem bewiesen.“, so die Ministerin.

Dorothee Wüst, Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz sagte: „Wir zeichnen heute Projekte aus, die geprägt sind von Nächstenliebe, sozialem und auch politischem Engagement. Sie schauen hin, wo Unterstützung benötigt wird, wo es nicht rund läuft, wo Menschen auf der Strecke bleiben, wo demokratische Rechte ausgehebelt werden. Hinschauen und Handeln ist ihre Devise. Und das macht Mut. Ob Haupt- oder Ehrenamtlich, ihr Engagement ist geprägt von Achtung und Respekt und der Überzeugung, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Sie stärken die Schwachen und eröffnen neue Perspektiven. Unbürokratisch und direkt helfen sie in Notlagen oder auch langfristig und lebensbegleitend. Sie machen deutlich, die Würde des Einzelnen ist nicht diskutierbar, sie muss geachtet und geschützt werden. In unterschiedlichster Weise stärken sie mit ihrem Einsatz ein Leben in Vielfalt und unsere Demokratie. Ihnen gehört unsere Anerkennung.“
Infos und Kontakte zu den geehrten Projekten
Bilder und Eindrücke von der Preisverleihung
(Dokumentation: Diakonie Hessen / Diether von Goddenthow /Rhein-Main.Eurokunst)