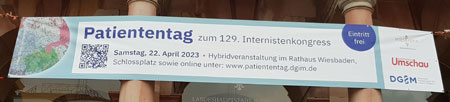Wiesbaden – Mit mehr als 8000 Internistinnen und Internisten vor Ort in Wiesbaden und online ging gestern der 130. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin zu Ende. Mit 1400 Vorträgen in insgesamt 410 wissenschaftlichen Sitzungen spiegelte das Programm des 130. Internistenkongresses erneut die gesamte Breite der Inneren Medizin wider. Zentrale Themen der Tagung waren die Chancen und Grenzen der Präzisionsmedizin, Forschung in der Inneren Medizin, der Umgang mit Fehlern sowie die Auswirkungen diverser Krisen – von Klimawandel bis Fachkräftemangel. Das zentrale Querschnitt-Thema war KI im medizinischen Alltag, denn seit Jahren und zusehends immer rascher durchdringt KI alle Bereiche der Medizin von der Allgemeinmedizin bis zur Urologie. Auf dem Kongress wurden die Chancen, Risiken und Vertrauenswürdigkeit einer „schönen“ oder – vielleicht auch – „bedrohlichen“ neuen Welt diskutiert.
Kann KI Zeitmangel in der Medizin „heilen“?

© Foto Diether von Goddenthow
Wäre ein vermehrter Einsatz von KI in der Medizin ein probates Mittel, ein an Zeitmangel erkranktes medizinisches Versorgungs-System zu heilen?
Gerade in der Inneren Medizin begegnet medizinisches Personal einer so großen Vielfalt an Krankheitsbildern, dass die Übersicht kaum noch zu wahren ist. Darüber hinaus müssen klinische Befunde, Laborwerte und Bildgebung zusammengeführt werden: Hier könnte eineKI-gestützte Entscheidungshilfe Wege zur Diagnose aufzeigen und wertvolle Zeit sparen. „Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels in der Medizin können technische Hilfsmittel, die den Arbeitsalltag erleichtern, extrem hilfreich dabei sein, unsere Aufmerksamkeit wieder mehr den Patientinnen und Patienten und ihren individuellen Bedürfnissen zuzuwenden“, sagt Kongresspräsident Professor Dr. med. Andreas Neubauer, Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Immunologie am UKGM in Marburg.
Aber wieviel Verantwortung sollte eine KI in der Medizin tragen? Wie weit darf und sollte unser Vertrauen gehen? „Die Frage müsste lauten: Entspricht das Vertrauen in die KI dem, was sie leisten kann? Wie bei jedem Hilfsmittel, dass in der Medizin genutzt wird, muss die oder der Behandelnde sich im Klaren darüber sein, was die Hilfe leisten kann – und was eben nicht“, sagt Professor Dr. Martin Hirsch, der das Institut für Künstliche Intelligenz am UKGM leitet und Mitglied der Kommission Digitale Transformation in der Inneren Medizin der DGIM ist.
Kann dies nicht garantiert werden, verlieren Patienten rasch ihr – mitunter ohnehin sehr ambivalentes – Vertrauen in KI-unterstützte Medizin. So gibt es gegenüber Apparate-Medizin, OP-Robotik oder Telemedizin ohnehin schon bei vielen Patienten gewisse Hemmschwelle. Es geht bei der KI also nicht bloß um technische Optimierung, sondern vor allem darum, Vertrauen dafür bei Patienten aufzubauen. Wie aber „konstituiert sich Vertrauen? Und was folgt daraus für das Design von Ki-Anwendungen?“ war eine der zentralen Fragestellung, über die die Psychologin und Doktorandin Nadine Schlicker, vom Institut für Ki in der Medizin an der Universität Marburg, referierte. Ihren Untersuchungen im Rahmen ihrer Doktorarbeit referierte, beispielsweise: „Wie kommen medizinische Laien zur Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit ihres KI-Arztes?“

Aber es geht nicht nur um das Vertrauen von Patienten, sondern auch um das der Ärzte in die KI. So kann ein zu hohes Maß an Vertrauen dazu führen, dass Ärztinnen und Ärzte sich zu unkritisch auf diese Technologie verlassen, während zu wenig Vertrauen darin resultieren kann, dass sie die Vorteile dieser Technologie nicht nutzen. „Denn trotz ihrer erheblichen Potentiale muss auch für KI stets die oberste ärztliche Maxime gelten: Primum nil nocere – das Bestmögliche erreichen, ohne zu schaden, und ein unausgewogenes Maß an Vertrauen zu ihr ist ein wichtiger Einflussfaktor“, unterstrich Professor Dr. med. Ivica Grgic, Oberarzt der Klinik für Nephrologie und Mitglied des Instituts für KI in Marburg, hinzu.
„Vertrauensbildende Maßnahmen“ – wie KI und Medizin zusammenkommen können
Damit KI-gestützte Entscheidungshilfen eine echte Erleichterung im Behandlungsalltag werden können und das Vertrauen von Ärzteschaft und Patientinnen und Patienten gleichermaßen genießen, gilt es – so Martin Hirsch – einige Punkte bei der Etablierung zu
beachten:
- Ärztinnen und Ärzte können nicht ersetzt werden! Das Vertrauensverhältnis und der Austausch zwischen Behandelnden und Patientin oder Patient ist entscheidend für den Behandlungserfolg und darf nicht von Hilfsmitteln ersetzt, sondern lediglich ergänzt werden.
- Ethische Standards entwickeln und der KI vermitteln: Gerade, aber nicht nur am Lebensende, gewinnt die ethische Komponente bei medizinischen Entscheidungen an Bedeutung. Nicht jede lebensverlängernde Maßnahme, die die KI vorschlägt, entspricht dem Wunsch der Patientin oder des Patienten und nicht alles, was medizinisch möglich ist, bringt einen vertretbaren Nutzen. „Ihre Wirkmächtigkeit für die Medizin kann KI nur entfalten, wenn wir klare ethische Rahmenbedingungen setzen“, so Hirsch.
- KI kann nicht im Sprint Einzug in die Medizin halten: Vor dem Einsatz von KI in der Medizin als Entscheidungshilfe muss die gesellschaftliche Auseinandersetzung zu ethischen Fragen in der Medizin stehen.
- Von der Behandlung zur Heilung: KI kann im Gesundheitssystem notwendige Freiräume schaffen, wenn wir sie so anlegen, dass sie ethisch geprägt, präventiv ausgerichtet und gesundheitsfördernd ist.
„Die KI wird uns keine schnelle Zeitersparnis bringen, aber mittelfristig echte Gewinne für ein Gesundheitssystem, das derzeit von massivem Fachkräftemangel getrieben ist“, so Hirsch.
KI-Assistenz aus der Notaufnahme
Im Rahmen des Ausstellungsbereichs DGIM Futur in der Halle Nord des RMCC Wiesbaden hatten die Kongressteilnehmer die Möglichkeit, eine KI-Assistenz aus der Notaufnahme kennenzulernen (DokPro, DokKab, DokBox), mittels VR-Brillen u.a. Organfunktionen zu erleben, ihre Fähigkeiten im Umgang mit virtuellen Notfallsituationen zu testen und neuartige, immersive medizinische Lern- und Onboarding-Konzepte kennenzulernen. Konzipiert wurde das Angebot von Kongresssekretär Professor Dr. med. Ivica Grgic und Professor Dr. Martin Hirsch.

Beim DokPro-Projekt handelt es sich um eine Ki-basierte Ersteinschätzung des Gesundheits-/Befindlichkeitszustands von Patienten. Es handelt sich dabei um eine modulare KI-Plattform, die, so die Info-Tafel, darauf ausgelegt ist, Patienteninformationen strukturiert zu erfassen und basierend darauf Ersteinschätzungen zur Weiterverwendung für den (Not-/Tele-Haus-)Arzt abzugeben. Die DokKab ist beispielsweise für den Einsatz in der klinischen Notfallstation vorgesehen. Die DokBox in Containergröße, verfügt zudem über einen variabel gestaltbaren Behandlungsraum, und soll in Kliniken, Altenheimen und Flüchtlingsunterkünften zum Einsatz kommen. Zudem ist auch der mobile Einsatz vorstellbar, um etwa Unterversorgung in ländlichen Gebieten entgegenzuwirken (einmal wöchentlich kommt der mobile Doc ins Dorf). Hierdurch könne man, so die Entwickler, unnötige Klinikbesuche vermeiden und Patienten einen niederschwelligen Zugang zu Untersuchungen ermöglichen.
Hohe Ehrungen während des Kongresses
Im Rahmen ihres Jahreskongresses und Fachtagung vergab die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM) außerdem ihre Forschungspreise, Ehrungen für verdiente Persönlichkeiten der Fachgesellschaft und die Medienpreise an Persönlichkeiten, die sich um die Innere Medizin, die internistische Forschung sowie die Vermittlung medizinischer Fragestellungen besonders verdient gemacht haben.
Höchste Auszeichnung der DGIM: Leopold-Lichtwitz-Medaille für Professor Gerd Hasenfuß
Die Leopold-Lichtwitz-Medaille der DGIM, die höchste Auszeichnung der Fachgesellschaft, erhielt in Anerkennung seiner großen Verdienste um die Innere Medizin Professor Dr. med. Gerd Hasenfuß. Hasenfuß ist seit 1998 Direktor der Klinik für Kardiologie und Pneumologie und Universitätsprofessor für Innere Medizin an der Universitätsmedizin Göttingen. Er ist mit zahlreichen Wissenschaftspreisen ausgezeichnet, darunter der Theodor-Frerichs-Preis der DGIM. 2015/2016 war er Vorsitzender und Kongresspräsident der 122. Jahrestagung der Fachgesellschaft. Unter seiner Leitung entstand die DGIM-Initiative „Klug entscheiden“, die bis heute unter Mitarbeit der internistischen Schwerpunktgesellschaften regelmäßig Über- und Unterversorgung in der Inneren Medizin benennt.
DGIM-Medienpreise: Erster Platz für „Wann stirbst Du endlich?“ in ZEIT Verbrechen
Die mit insgesamt 10.000 Euro dotierten DGIM Medienpreise wurden in diesem Jahr an Beiträge zum Thema „Pflegekrise: Gute Medizin braucht gute Pflege“ vergeben. Die erste Auszeichnung ging an ein junges Autorenteam, bestehend aus Martin Hogger, Kristina Ratsch, Marina Klimchuk und David Holzapfel für Ihren Beitrag „Wann stirbst du endlich?“ in ZEIT Verbrechen. Der zweite Medienpreis wurde an Carina Frey vergeben für ihren Beitrag „Heute hier, morgen dort“, veröffentlicht in „brand eins“. Den dritten Preis erhielt Autorin Nina Himmer für den Beitrag „Ein Heim sucht nach Rettung“, der in der Apotheken Umschau erschienen ist.
Vergabe von drei Ehrenmitgliedschaften
Des Weiteren ernannte die Fachgesellschaft im Rahmen der festlichen Abendveranstaltung drei verdiente Persönlichkeiten zu Ehrenmitgliedern: den Internisten und Kardiologe Professor Dr. med. Georg Ertl, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Medizinischen Klinik und Poliklinik I sowie bis 2020 Inhaber des Lehrstuhls für Innere Medizin am Universitätsklinikums Würzburg; er ist aktuell Generalsekretär der DGIM und trug auch davor schon als Vorsitzender entscheidend zum Erfolg der Fachgesellschaft bei. Seit 2002 ist der zudem Mitglied der Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
Professor Dr. med. Hans-Jochem Kolb ist Internist und Hämatoonkologe und führte 1975 die erste erfolgreiche Knochenmarkstransplantation in Deutschland bei einem Kind mit aplastischer Anämie durch. 1978 folgte die erste erfolgreiche Transplantation bei Erwachsenen mit refraktärer Leukämie und aplastischer Anämie. Seit 1985 hatte Kolb eine C2-Professur für maligne Hämatologie an der Universität München inne, ab 1996 ebendort eine C3-Professur. Auf ihn geht das Konzept der Donor-Lymphozytentransfusion als kurative Therapie bei hämatologischen Neoplasien zurück.
Dr. Bernd-Michael Neese befasst sich als Germanist und Historiker mit der Stadtgeschichte Wiesbadens und hat hierzu zahlreiche Bücher und Artikel veröffentlicht. Seine Abhandlung „Der Internistenkongress in Wiesbaden 1882–2022“ entwickelte sich in diesem Zusammenhang. Bernd-Michael Neese befasste sich zudem mit Dr. Emil Pfeiffer. Der lebenslang in Wiesbaden praktizierende Arzt war mit einer 32-jährigen Amtszeit der am längsten wirkende Generalsekretär der DGIM. Die Ergebnisse der Untersuchungen zu Leben und Werk von Emil Pfeiffer sollen Ende des Jahres 2024 in einer umfangreichen Studie dargestellt werden.
Mit dem Ende der Fachtagung übernahm Professor Dr. med. Jan Galle, Lüdenscheid, den Vorsitz der Fachgesellschaft. Den vom 3. bis 6. Mai 2025 stattfindenden 131. Internistenkongress stellt der Nephrologe unter das Motto „Resilienz – sich und andere stärken“.
Weitere Informationen rund um den Kongress und sein Programm mit über 1000 (hybriden) Vorträgen.
(DGIM / Diether von Goddenthow)