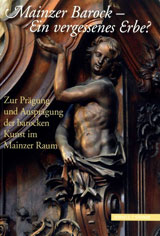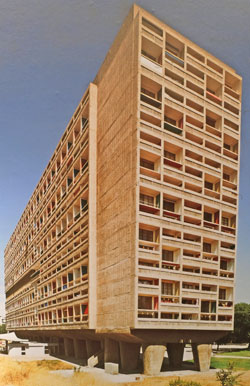Mainzer Barock – Ein vergessenes Erbe? Buchvorstellung und Vortrag im Erthaler Hof
Wer in diesen Tagen durch Mainz spaziert, dem fallen eine Reihe von markanten Bauten auf, die vor kurzem restauriert wurden, an denen gerade Baumaßnahmen laufen oder über deren Zukunft noch diskutiert wird. Zu ihnen gehören der Domwestturm, die Ignazkirche, das Kurfürstliche Schloss, das Deutschhaus, das Haus zum Römischen Kaiser am Gutenbergmuseum, der Osteiner Hof am Schillerplatz und der Eltzer Hof im Geviert des ehem. kurfürstlichen Marstalls.
Sie alle stehen beispielhaft für den Mainzer Barock, der von vielen Besuchern der Stadt oft nur am Rande wahrgenommen wird. Dabei hat die ehemalige kurfürstliche Haupt- und Residenzstadt mit ihren Pfarr- und Klosterkirchen und den zahlreichen Adelshöfen zahlreiche bedeutende Werke dieser Zeit zu bieten und das trotz der großen Zerstörungen bei der Belagerung 1793 und während des Zweiten Weltkrieges.
Nun haben gestern die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und die Katholische Akademie des Bistums Mainz ihr gemeinsam mit hochkarätigen Beiträgern herausgegebenes Buch Mainzer Barock – Ein vergessenes Erbe? Zur Prägung und Ausprägung der barocken Kunst im Mainzer Raum, erschienen im Verlag Schnell und Steiner, Regensburg 2017, 272 Seiten, Euro 39,95 im Barocksaal des Erthaler Hofs der Öffentlichkeit vorgestellt.

Dr. Stefanie Hahn, Kulturbeauftragte im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz für das Kulturelle Erbe, Denkmalpflege, Burgen, Schlösser und viele mehr, sagte, dass man für die Buchvorstellung „Mainzer Barock – Eine vergessenes Erbe“, kaum hätte „ein stimmigeres Ambiente finden können, als diesen Festsaal im Erthaler Hof“. Dieser sei nicht nur architektonisch bedeutend, sondern gehöre auch zu den wenigen im zweiten Weltkrieg nicht zerstörten Adelshöfen in Mainz. Er wäre in den 270 Jahren seit seiner Erbauung ein wichtiger Zeuge historischer Entwicklungen und Ereignisse in Mainz. Wer jedoch mehr über dieses bauhistorische Juwel, in dem die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz ihren Sitz hat, erfahren möchte, müsse das Buch kaufen. Im dritten Kapitel widmet sich Dr. Georg Peter Karn, Direktion Landesdenkmalpflege der GDKE, in seinem bemerkenswerten Buchbeitrag „Mainzer Adelshöfe – Beobachtungen zum Profanbau in der kurfürstlichen Residenz“ der Geschichte und stadtbildprägenden Wirkung der Adelshöfe.
Die Herausgeber behandelten eine Epoche, die zwar im Mainzer Stadtbild an vielen Stellen sehr prominent gegenwärtig sei, im öffentlichen Bewusstsein aber deutlich weniger präsent vertreten wäre, so Dr. Hahn weiter. Und es wäre „den Bauten und ihrer Bedeutung für das Mainzer Stadtbild zu wünschen, dass dieser Band an dieser Wahrnehmung etwas ändern könnte“, schrieb die Kulturbeauftragte den Mainzern Bauplanern ins Stammbuch.
Das Buch sei dabei kein Reiseführer, mit dem man die Barocke Stadt Mainz durchwandere. Es zeige vielmehr in den 8 Beiträgen dieser Fachleute ganz unterschiedliche Perspektiven und Darstellungen auf, mit den man sich gemeinsam den Orten nähern könne.
„Dieser Band weist damit auch auf die große kulturgeschichtliche Tradition von Rheinland-Pfalz hin, dessen Landeswappen die Erinnerung an die Kurfürstentümer Trier, Mainz und Pfalz wachhält“, so Thomas Metz, Generaldirektor der GDKE.

Die neue Publikation basiert auf einer Tagung, die 2014 von der Akademie des Bistums Mainz, Erbacher Hof, und der GDKE in Mainz im Haus am Dom veranstaltet wurde und die charakteristische Beispiele aus den Bereichen Architektur, Skulptur und Malerei untersucht und dabei die Frage nach dem typisch „Mainzischen“ verfolgte. „Da es damals so viele Nachfragen gab und das Thema auf breites Interesse stieß, haben wir uns entschlossen, die Beiträge in gedruckter Form zugänglich zu machen und damit die Diskussion über den Mainzer Barock weiter voranzutreiben“, erläuterte Dr. Georg Peter Kran, der parallel zu seinem Beitrag über Mainzer Adelshöfe gemeinsam mit Dr. Meinrad v. Engelberg von der TU Darmstadt und Dr. Felicitas Jansons, Leiterin der Akademie des Bistums Mainz, das Werk redaktionell betreut hat.

Dr. Meinrad von Engelberg, Herausgeber und Autor des Einstiegbeitrags „Was ist Mainzer Barock? Überlegungen zur Charakteristik einer ‚Kunstlandschaft in 10 Thesen'“ gab in seinem Festvortrag einen grandiosen Überblick über den Mainzer Barock, wobei er unter anderem aufzeigte, dass der Mainzer Diözesanverband, einmal der größte in ganz Europa und geistiges Zentrum war. Anders als beispielsweise in vielen anderen Städten mit bedeutendem barocken Erbe, welches häufig mit einem bestimmten Baumeister-Namen wie in Würzburg mit Balthasar Neumann, oder landestypischen barocken Stilrichtungen wie bayerischer Barock oder Florentiner Renaissance, assoziiert würde, ginge das in Mainz so nicht. Vielmehr hätten in Mainz viele der besten Baumeister gewirkt, so dass keiner besonders repräsentativ für den Mainzer Barock sei.
Aber die Außenwahrnehmung baugeschichtlicher Mainzer Stilepochen habe auch viel damit zu tun, dass es ja in Mainz noch ganz andere Identifikationsorte gäbe, so v. Engelberg. Das Mittelalter spiele eine ganz große Rolle, in letzter Zeit wieder verstärkt, etwa auch durch die Initiative, „das jüdische Erbe hier am Mittelrhein mit den Städten Mainz, Speyer und Worms jetzt unter einen besonderen UNESCO-Schutz zu stellen“ , was dieser historischen Phase natürlich einen besonderen Wert verliehen habe. Und auch „die Ausgrabungen in der Johannes-Kirche, die hier ein ganz neues Interesse auch auf das Frühmittelalter gelenkt haben“, so von v. Engelberg.
Die andere Außenwahrnehmung von Mainz wäre „der Römerbezug, der ja für Mainz, auch für die Identifikation sehr wichtig ist, mit dem Römer-Museum, mit dem Drususstein usw.“, so dass es verständlich sei, dass eigentlich die Epochen in der öffentlichen Wahrnehmung nicht unbedingt der Barock sei, so v. Engelberg.
Ein weiterer Grund, warum das so sei, hänge auch damit zusammen, dass in Mainz die barocke Bausubstanz nicht erst im Bombenhagel des 2. Weltkrieges, sondern bekanntlich schon 1793 im Revolutionstruppenkampf zwischen Preußen und den Franzosen, die in der Stadt saßen, passiert sei, so v. Engelberg. Da sei in Mainz schon viel kaputtgegangen an Material, „aber auch sozusagen an kollektiver Substanz. Denn die Eliten, die das hier getragen und gebaut haben, die sowas hier wie den Erthaler Hof gebaut haben, dass war eben der Stifts-Adel, also diejenigen, die den geistlichen Kurstaat getragen haben“, erläuterte v. Engelberg. Und diese geistigen Eliten „waren auch mit der Revolution dann vertrieben, und aus der politischen Herrschaft ausgeschaltet“. Anders in Köln: dort sei die römisch-katholische Tradition praktisch völlig ungebrochen geblieben, trotz Preußen usw.“, veranschaulichte v. Engelberg eine seiner Thesen und gab zum Abschluss einen Kurzüberblick über alle acht wissenschaftlich fundierten – laienverständlich geschriebenen – Buchkapitel.
Absolut empfehlenswert! Herausgeber: Generaldirektion Kulturelles Erbe, Katholische Akademie des Bistums Mainz. Mainzer Barock – Ein vergessenes Erbe? Zur Prägung und Ausprägung der barocken Kunst im Mainzer Raum, erschienen im Verlag Schnell und Steiner, Regensburg 2017, 272 Seiten, Euro 39,95
(Diether v. Goddenthow /Rhein-Main.Eurokunst)