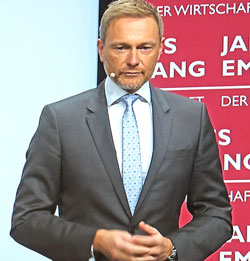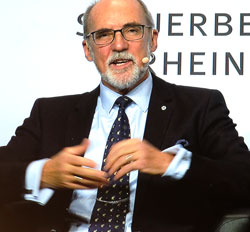Mehrere tausend Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur waren am Donnerstag, 25. Januar, zum „Jahresempfang der Wirtschaft“ mit Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck in die ausgebuchte Mainzer Rheingoldhalle gekommen. 15 Kammern und Institutionen des Mittelstands, des Handwerks, der freien Berufe und der Landwirtschaft aus Rheinland-Pfalz hatten zum Mainzer Großereignis eingeladen, das als größter Jahresempfang der regionalen Wirtschaft in Deutschland gilt – und als Plattform für den Dialog mit Entscheidern aus Bundes- und Landespolitik. Habeck war im Rahmen seiner Rheinland-Pfalz-Reise als Keynote-Speaker in die Mainzer Rheingoldhalle gekommen, nachdem er zuvor bei Mainzer Großunternehmen wie Schott und Werner & Mertz zu Gast war.

IHK-Präsident Walden für „Praxis-Check“ bei neuen Gesetzen
Die Veranstalter des Jahresempfangs nutzten die Möglichkeit, um die Stimmungslage in der Wirtschaft und ihre Positionen deutlich zu machen: „Viele unserer Betriebe wissen nicht, wie es weitergehen soll“, sagte IHK-Präsident Dr. Marcus Walden in seiner Begrüßung. „Inflation, Energie- und Rohstoffkosten belasten die Bilanzen. Dazu kommen Lieferschwierigkeiten, lähmende Bürokratie und der Arbeitskräftemangel. Vor allem: Es fehlt das Vertrauen, dass Entscheidungen Bestand haben. Weshalb Unternehmen weniger investieren. Darüber müssen wir beim ‚Jahresempfang der Wirtschaft‘ sprechen.“

Besondere Sorge mache den Betrieben die zunehmende Bürokratisierung. Denn, wenn Berichtspflichten das Tagesgeschäft lähmten, „können wir die großen Herausforderungen unserer Zeit nicht lösen“. Service-Dienstleistung für alle, die jetzt hektisch für ihren Betrieb nachdenken, wieviel Grad das denn sein müssen: mindestens 21 Grad, sagt die Technische Regelung für Arbeitsstätten, die sogenannte ASR 3.5. Und selbst an das Lüften von Toilettenräumen und die Wechselwirkung des Lüftungsvorgangs mit der Raumtemperatur wurde gedacht. Ich zitiere aus der technischen Regelung: „In Toilettenräumen darf die Lufttemperatur durch Lüftungsvorgänge, die durch Benutzer ausgelöst werden, kurzzeitig unterschritten werden“. Ende des Zitats – mehr muss man, glaube ich, nicht dazu sagen.“, so Walden.
Obwohl die Bundesregierung bereits vier Bürokratieentlastungsgesetze auf den Weg gebracht habe, kämen „immer noch mehr neue Vorschriften hinzu als alte wegfallen.“, so der IHK-Präsident, und forderte „einen verbindlichen Praxis-Check für neue Gesetze. Da helfen die Kammern auch gerne mit.“ Großer Applaus. „Ich schätze mal, dass es Herr Habeck genauso sieht“.
„Neben Messwerten hilft manchmal aber vielleicht auch einfach gesunder Menschenverstand. Und das Vertrauen, dass verantwortungsbewusste Unternehmerinnen und Unternehmer vieles auch ohne seitenlange Regelungen richtig machen.“, so Walden. Und hätten die Unternehmer schließlich „alle Verordnungen gelesen, verstanden und erfüllt, folgen endlose Planungs- und Genehmigungsverfahren“, spricht der IHK-Präsident den Unternehmern und Freiberuflern im Saal aus der Seele. Innovationsgeschwindigkeit sähe anders aus!. Statt noch mehr Bürokratie würde dringend „ein klares Bekenntnis zu unserem Industrie- und Innovationsstandort – und zu allem, was Innovation schafft“, gebraucht. Dazu gehörten „Investitionen in die Infrastruktur, in Forschung und Entwicklung. Und vor allem auch: eine sichere Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen. Stattdessen verdoppeln die Betreiber der Stromübertragungsnetze in Deutschland zum Jahreswechsel die Entgelte. Das schlägt sich bei jedem Einzelnen von uns und für alle Branchen in der Stromrechnung nieder. Für einen industriellen Mittelständler bedeutet das leicht mehrere Hunderttausend Euro. In Rheinland-Pfalz betrifft das allein gut 13.200 Industriebetriebe, die knapp ein Viertel des Bruttosozialproduktes erwirtschaften. Vertrauensbildende Maßnahmen, die wichtig für alle sind, die investieren wollen und sollen, sehen anders aus“, so der IHK-Präsident. Er rief Robert Habeck zu: „Die Erwartungen an Sie für das Jahr 2024 sind hoch. Sie haben es mit in der Hand, das Vertrauen der Unternehmen in den Standort Deutschland wieder zu stärken.“
Talk – Wie soll Bürokratieabbau mit Lieferkettengesetz gehen?

Bürokratiekritik war auch vorherrschendes Thema der anschließende Talkrunde, die souverän und kenntnisreich von Patricia Küll moderiert wurde. Auf dem Podium der Rheingold-Halle: Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Hans-Jörg Friese, Präsident der Handwerkskammer Rheinhessen, Andreas Creutzmann, Landespräsident der Wirtschaftsprüferkammer und Dr. Wilfried Woop, Präsident der Landeszahnärztekammer. HWK-Präsident Friese, als erster befragt, redet Klartext: „Der Frust ist groß, und der steigt immer mehr an.“ Dabei sei das größte Problem für das Handwerk die wachsende Bürokratie. Erst danach käme der Fachkräftemangel, so Friese, der die bürokratische Absurdität manch überflüssiger Regelung am Genehmigungsverfahren für das Bewegen von einem Kran von A nach B plausibilisiert. Wie ihm ein Kollege aus der Baubranche zugetragen habe, würden Deutschlandweit alle Anträge bewilligt. Doch die Vorlaufzeit bis zur Genehmigung läge bei sechs bis acht Wochen. Wenn aber ohnehin alle beantragten „Kranfahrten“ genehmigt würden, „bräuchte man doch gar keine Anträge zu stellen.“ Er habe oftmals das Gefühl, dass Politiker gar nicht zuhörten.
Andreas Creutzmann, Landespräsident der Wirtschaftsprüferkammer, bestätigte Frieses Ausführungen, was tägliche Praxis der Steuerberater wäre, die dann Lösungen finden müssten. Vor allem, so Creutzmann, wie solle Bürokratieabbau angesichts beispielsweise des neuen „Lieferkettensorgfaltpflichtgesetz“ funktionieren? Inzwischen bereite ja Brüssel noch eine Verschärfung des Lieferkettensorgfaltpflichtgesetzes vor. Geplant sei auch eine indirekte Lieferkettenprüfungspflicht für Unternehmen ab 1000 Mitarbeitern, also die Pflicht, auch die Lieferanten der Lieferanten auf Menschenrechts- und Umweltrechtsverletzungen hin zu überprüfen. Und das ganze müsse ja behördlicherseits kontrolliert werden, bedeute also mehr Beamte, mehr Bürokratie. In den Betrieben verlange das Gesetz ein systematisches Risikomanagement und die Unternehmen sollen elektronisch an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle berichten. Und wer solle all die Angaben überprüfen? Gut, für seine Branchen wüchsen die Aufgaben, räumte er auf Nachfrage Particia Külls ein.
Die Ministerpräsidentin Malu Dreyer versicherte, insbesondere an den Handwerks-Präsidenten gerichtet, dass sie die Kritik an der Bürokratie „sehr ernst nimmt“, und alles „aufgenommen würde“. Aber soweit ihr bekannt sei, führe die Landesregierung mit den verschiedenen Kammern intensive im Gespräche, um gemeinsam die Dinge zu erleichtern. Man sei ja in einem Veränderungsjahrzehnt, in dem es darum ginge, die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz zu erhalten und gut zu gestalten. „Meine Landesregierung setzt sich für stabile Rahmenbedingungen ein und unterstützt im Bundesrat die Initiativen zur Entlastung der Unternehmen“, versicherte Ministerpräsidentin Malu Dreyer. „Wir setzen in Rheinland-Pfalz ganz stark auf wirtschaftliche Zukunftsfelder wie Wasserstoff, Künstliche Intelligenz und die Biotechnologie. Die Ansiedlung des Unternehmens Eli Lilly in Alzey ist nur eines der Ergebnisse der langjährigen strategischen Forschungspolitik der Landesregierung, mit der wir die Biotechnologie systematisch fördern. Wir wollen mit Ihnen als Unternehmen Gewinner der Digitalisierung werden, mit guter Arbeit und wirtschaftlichen Erfolgen auf traditionellen und neuen Märkten“, so die Ministerpräsidentin.

Politik müsse unternehmerischer Denken – Keynote des Wirtschaftsministers Dr. Robert Habeck
Als Hauptredner Dr. Robert Habeck ans Podium trat, war die Stimmung in der mehrere tausend Gäste fassenden Rheingoldhalle aufgeheizt und die Erwartungen hoch. Doch der Wirtschaftsminister schaffte es quasi im Handumdrehen mit einer Fragestellung zur mentalen Verfassung aus dem Sport am Beispiel der aktuellen Vorabend-Handballer-Niederlage gegen Kroatien die Gemüter im Saal positiv zu pushen: „Will man gewinnen, und hat man Spaß daran, oder will man, nur nicht verlieren?“ Es reiche seiner Meinung nicht, „nicht nur nicht verlieren zu wollen“, sondern es gehe darum, „gewinnen zu wollen!“, motivierte der Wirtschaftsminister.

Er teile die Kritik an der überbordenden Bürokratie und prangerte unter anderem die unglaublichen Restaurant- und Speisekarten-Vorschriften aus dem eigenen Wirtschaftsministerium an: Da konnte beispielsweise ein namhafter Restaurantbesitzer einen Koch aus Hongkong letztlich doch nicht einstellen, weil diesem nach monatelangen Verhandlungen trotz vorliegendem deutschen Arbeitsvertrag der beantragte Aufenthaltstitel verwehrt wurde mit der aberwitzigen Begründung: Im betreffenden Restaurant würde nicht zu 90 Prozent chinesisch gekocht, somit würde auch kein chinesischer Koch benötigt.
Aber wo lägen die Ursachen für diese Flut von Regelungen und Vorschriften – „wie konnte es so weit kommen, dass wir so falsch abgebogen sind?“, fragte der Wirtschaftsminister selbstkritisch. „Wir haben große politische Entscheidungen an die Gerichte ausgelagert“, so Habeck. Er sei auch genervt darüber, dass immer öfter Verwaltungsgerichte darüber entschieden, was Staat und Verwaltungen überhaupt noch machen dürften. Um möglichst jedes Risiko auszuschließen, gebe es praktisch für jeden Fall eine Regel. Und weil aber eine gute Verwaltung keine Fehler machen und vor Gericht nicht verlieren wolle, stecke sie nicht zuletzt deshalb so viel Kraft in exakte Einhaltung von Regeln und Vorschriften, um eine gute Verwaltung zu sein“, was letztlich keinem der Beteiligten so wirklich gefiele, so der Wirtschaftsminister. Erforderte die Politik auf, „mehr Mut zum Risiko und unternehmerisches Handeln“ zu entwickeln. Dafür bekam er großen Applaus. Dazu gehöre jedoch, „dass diejenigen, die ins Risiko gingen, wenn dann mal etwas schiefginge, nicht gleich den vollen Zorn abkriegen“. Das bedeute natürlich nicht, dass Politiker andauernd Fehler begehen sollten. Tatsächlich müsse man aber mutiger werden und sich auch zutrauen, einen Fehler zu machen.
Als zweites großes Thema ging der Wirtschaftsminister auf das Thema Fachkräftemangel ein: Ohne Weltoffenheit und Willkommenskultur gelänge es kaum, zukünftig genügend Arbeitskräfte zu gewinnen. Das gelte insbesondere für Rheinland-Pfalz, das ökonomisch betrachtet über dem deutschen Exportdurchschnitt liege. Dass dies insbesondere auch ein Verdienst von Zuwanderern sei, stützte Habeck mit der Feststellung, dass heute zwölf von insgesamt 45 Millionen Erwerbstätigen Menschen mit Migrationshintergrund seien. Ohne die Migration gäbe es in diesem Jahr 50.000 Auszubildende weniger. 14 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seien Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft hätten. Er habe ja gar nichts gegen einen fröhlichen Patriotismus, etwa bei großen Sportveranstaltungen, so Habeck, aber einen engstirnigen Nationalismus mit Abschottung, Ausgrenzung und hochgezogenen Grenzen sei das Gegenteil von Weltoffenheit. „Wenn wir Weltoffenheit nicht leben, bricht unsere Wirtschaft zusammen“, warnt Habeck. Eine Abschiebung von diesen Menschen, wie es in rechtsextremen Kreisen ventiliert werde, „wäre das Ende unserer Wirtschaft und weltoffenen Demokratie“.
Wie zuvor schon Ministerpräsidentin Malu Dreyer beim Talk betont hatte, freute es auch Robert Habeck, dass in diesen Wochen Hunderttausende bundesweit lautstark auf die Straße gingen, um „ein klares Signal gegen Rechts“ zu setzten.
Weitere Informationen und Bilder: IHK-Rheinland-Pfalz