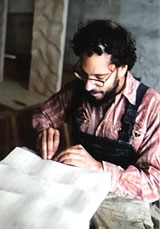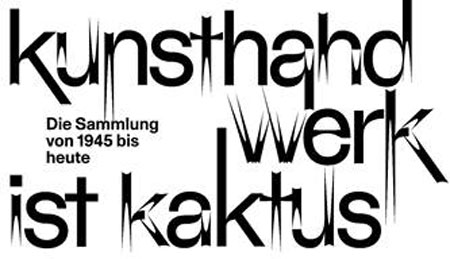Frankfurt am Main, 26. Januar 2024. Ausgezeichnete Arbeiten, strahlende Gesichter: Am 26. Januar 2024 wurde der 72. Hessische Staatspreis für das deutsche Kunsthandwerk verliehen. Über den Award freuten sich Christoph Leuner, Philipp Gröninger und Dora Herrmann sowie über den Förderpreis die Newcomerin Emma Brix. Der feierliche Festakt fand im Rahmen der internationalen Konsumgütermesse Ambiente statt, auf der noch bis zum 30. Januar die Ausstellung aller 25 nominierten Arbeiten zu sehen ist.
Produkte, die jeder kennt – und die doch so besonders gedacht und gemacht sind, dass sie die erfahrene Fachjury im Sturm erobert haben: Den ersten Platz in dem Wettbewerb um den Hessischen Staatspreis für das deutsche Kunsthandwerk erlangte der Schreinermeister Christoph Leuner mit seinen künstlerisch gearbeiteten Dosenobjekten „Hohl-Körper“. Zweiter wurde der Gold- und Silberschmiedemeister Philipp Gröninger mit seiner handgeschmiedeten silberne Kaffeepresse ausgezeichnet. Die Handweberin Dora Herrmann erhielt den dritten Preis für ihren zeitgemäßen konzeptionellen Ansatz der Wolldecke unter dem Label „Gemeinsam Regional“. Über den Förderpreis freut sich die Absolventin der Kunsthochschule Burg Giebichenstein Emma Brix, die in ihren „Luftschlössern“ die Faszination der Weihnachtspyramiden in einen neuen Kontext setzt.

Der Hessische Staatspreis gilt als einer der wichtigsten und renommiertesten Auszeichnungen für das deutsche Kunsthandwerk. In diesem Jahr wurde das Preisgeld von 8.500 Euro auf insgesamt 13.000 Euro angehoben. Kaweh Mansoori, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, sagte bei der Auszeichnung: „Allen Bewerberinnen und Bewerbern, die sich für den Hessischen Staatspreis für das Deutsche Kunsthandwerk beworben haben, möchte ich meine große Anerkennung für Ihre Arbeit aussprechen. Sie spiegeln die Vielfalt des Kunsthandwerks mit seiner tiefen Verbindung zwischen Tradition und Moderne, Individualität und Nachhaltigkeit wider. Unsere Wertschätzung für die herausragenden Leistungen zeigen wir mit diesem Preis und mit einer besonderen Veränderung ab diesem Jahr – der Erhöhung der Preisgelder auf insgesamt 13.000 Euro.“
Zum Wettbewerb 2024 hatten rund 150 Kunsthandwerker*innen ihre Arbeiten eingereicht und damit fast 50 mehr als im Vorjahr. Besonders ins Auge fällt der gestiegene Anteil junger und erstmaliger Teilnehmer*innen. Diese positive Entwicklung betonte Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt, im Rahmen der festlichen Preisverleihung: „Das deutsche Kunsthandhandwerk hat traditionell eine besondere Bedeutung für die Ambiente, deren Aufgabe es unter anderem ist, den Facettenreichtum zeitgenössischer Gestaltungskunst zu spiegeln. Daher freue ich mich sehr, dass sich das deutsche Kunsthandwerk heute so vital und jung präsentiert.“ Insgesamt zeichnen sich die nominierten Einreichungen durch ihre beeindruckend kontemporären Ansätze aus. Darin überführen die Kunsthandwerker aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit und Entschleunigung in anspruchsvolle und poetische Arbeiten, die durch einen hohen qualitativen und konzeptionellen Anspruch auffallen. In diesem Kontext setzt auch gerade die jüngere Generation klare Statements und zeigt Werke, in denen sie dem technisierten und schnelllebigen Lifestyle ihre große Wertschätzung für regionale Traditionen, Techniken und Materialien entgegensetzt. Die Ausstellung aller nominierten Arbeiten ist in der Halle 3.1 Stand J71 zu sehen.
Die Jury des Hessischen Staatspreises 2024.
Die fünfköpfige Jury setzt sich aus Persönlichkeiten aus dem Bereich des Kunsthandwerks und des Designs zusammen. Die Jurymitglieder 2024 sind:
- Alexandra Gerlach, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum
- Dr. Sabine Wilp, Bundesverband Kunsthandwerk
- Prof. Matthias Wagner K, Museum Angewandte Kunst
- Britt Fröse, Handwerkskammer Wiesbaden
- Tischlerei Sommer, 1. Preisträger 2023
- Preisträger*innen 2024 – Werk und Jurystatement
1. Preis: Christoph Leuner für Dosenobjekte „HOHL-KÖRPER“

Christoph Leuner (geb. 1956), Schreinermeister aus Garmisch-Partenkirchen, beschäftigt sich schon lange mit dem Drechseln von Hohlkörpern: Dosenobjekte, in denen Menschen Dinge aufbewahren, die für sie eine besondere Bedeutung haben – seien es ganz reale Objekte oder auch Gedanken, Wünsche und Ideen.

Mit der neuen Hohl-Körper Serie #12 setzt er sich mit der Frage auseinander, ob das Aufbewahren von bedeutungsvollem Inhalt auch ein wertvolles Material des Gefäßes verlangt. Oder anders gefragt: Kann ein eher preiswertes, zweitrangiges Material auch zum Hüter und Träger von Bedeutungen werden? Für die Dosen dieser Reihe wurden Spanplatten und MDF-Platten miteinander verleimt und dann von Hand gedrechselt. Dieses eher einfache Material künstlerisch so zu bearbeiten, dass die haptischen und ästhetischen Reize hervortreten, war eine spannende Herausforderung. Die Jury zeigte sich begeistert und erkannte Christoph Leuner einstimmig den ersten Preis des Hessischen Staatspreises für das Deutsche Kunsthandwerk 2024 zu.
2. Preis: Philipp Gröninger für Handgeschmiedete Kaffeepresse aus Silber

Philipp Gröninger (geb. 1984) trat bereits früh in die Fußstapfen seines Vaters und hatte schon als kleiner Junge seine eigene Werkbank. Seither beschäftigt er sich kontinuierlich mit der Arbeit mit Edelmetallen und schafft anspruchsvolle Designstücke für die feine Tafel. 2015 schloss er seine Berufsausbildung zum Gold- und Silberschmiedemeister ab, bildete sich vielfach weiter und zog 2022 zog mit seiner Werkstatt nach Caan in den Westerwald.
Gröningers anspruchsvolle Arbeiten sind geprägt von der Hingabe zu immer neuen gestalterischen Herausforderung. In diesem Kontext entstand auch die handgeschmiedete silberne Kaffeepresse mit dem hölzernen Griff. Sie besticht durch eine gradlinige Formensprache und modernes Design.

Elegant und trotzdem nicht mit dem Nimbus des unberührbaren Silbers behaftet, verlangt sie gerade danach, in einer edlen Küche zum Einsatz zu kommen. Die Jury zeigte sich fasziniert und vergab mit Freude den zweiten Preis für diese Einreichung.
3. Preis: Dora Herrmann für Wolldecke des Labels „Gemeinsam Regional“

Dora Herrmann (geb. 1965) ist Handweberin gründete 1993 die eigene Werkstatt im Spritzenhaus in Wennigsen / Bredenbeck. In ihrer Arbeit ist sie stark in der Region verankert. Aus diesem Ansatz heraus entstand das ausgezeichnete Produkt. Eine Decke kann einen in einem Stück komplett umhüllen, bietet Schutz und stellt so eine Art Zuhause zum Mitnehmen dar. Das ausgezeichnete Textil ist darüber hinaus mit dem Begriff „Zuhause“ eng verbunden: Die Decke entstand unter dem Label „Gemeinsam Regional“ firmiert. Im Rahmen dieser Kooperation arbeiten drei Frauen zusammen, die im Umkreis von 20 Kilometern in der Peripherie von Hannover leben: eine Züchterin von
rauwolligen Pommerschen Landschafen, die Inhaberin der „kleinen Spinnerei“, die die Schafwolle zu einem mitteldicken, zweifädigem Garn verarbeitet, und eine Handweberin, die aus dem Material mit seiner eigenwilligen Struktur eine Decke webt, in der sich der Farbenreichtum der kleinen Herde widerspiegelt.
Zum Hintergrund: In Deutschland werden kaum noch Garne produziert. Regionale Wolle endet in der Regel als wertloser Abfall oder maximal als Dünger. Die preisgekrönte Decke zeigt, auf, dass heimische Wolle durchaus ein hochwertiges, regionales Material darstellt, aus dem besondere und nachhaltige Produkte entstehen können. Die Jury hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, den dritten Preis an Dora Herrmann zu vergeben und will damit explizit auch auf das wichtige Thema einer achtsamen und regionalen Produktion aufmerksam machen.
Förderpreis:

Emma Brix (geb. 1997) hat 2023 ihr Bachelor-Studium an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle abgeschlossen. 2021 absolvierte sich ein Praktikum als Gestalterin bei Emil A. Schalling KG Erzgebirgisches Kunstgewerbe in Seiffen, in dessen Rahmen die ausgezeichnete Arbeit entstand. Darin widmet sie sich einem gut bekannten Produkt, das bisher eher weniger im Fokus der jungen Generation stand.
Die erzgebirgische Weihnachtspyramide ziert in der Adventszeit viele Wohnungen – ein bisschen altbacken, ein bisschen traditionell, ein bisschen heimelig. In ihrer Arbeit greift Brix die gesamte Faszination der Weihnachtspyramiden auf und setzt diese in einen neuen Kontext. Anstelle von Figuren drehen sich kleine reifengedrehte Häuser wie von Zauberhand durch Torbögen hindurch. Brix „Luftschlösser“ entstehen in Kooperation mit der Firma Emil A. Schalling. Das Besondere: Die saisonunabhängigen Designs können
das ganze Jahr hindurch zum Einsatz kommen. Dabei brauchen sie keine Kerzen, sondern können einfach auf der Fensterbank oder dem Kaminsims stehen. Schon der kleinste Luftzug setzt die „fliegende Stadt“ in Bewegung. Eine absolut gelungene Mischung von Kunsthandwerk und Design befand die Jury und erkannte Emma Brix den Förderpreis zu.
Hessischer Staatspreis für das deutsche Kunsthandwerk
Der Hessische Staatspreis gilt als der erste Staatspreis in Deutschland und stellt bis heute einer der wichtigsten Preise für das deutsche Kunsthandwerk dar. Ins Leben gerufen wurde er 1951 auf Initiative des Kunsthandwerk Hessen e. V., um einen Anreiz für
besonders kreative Leistungen zu schaffen. Seitdem sind jährlich Kunsthandwerker*innen aus der gesamten Bundesrepublik dazu eingeladen, sich mit ihre besten aktuellen Arbeiten dem Wettbewerb zu stellen. Im Fokus stehen dabei überzeugende eigenständige Gestaltungsansätze, Innovationen, Beherrschung von Material und Technik sowie ein überzeugendes Gesamtbild des Oeuvres. Die feierliche Preisverleihung und die Ausstellung aller nominierten Einreichungen finden traditionell im Rahmen der Frankfurter Konsumgütermessen statt.
Die Ambiente findet 2024 erneut zeitgleich mit der Christmasworld und Creativeworld auf dem Frankfurter Messegelände statt:
- Ambiente/Christmasworld: 26. bis 30. Januar 2024
- Creativeworld: 27. bis 30. Januar 2024
Weitere Informationen zum Hessischen Staatspreis für das Kunsthandwerk